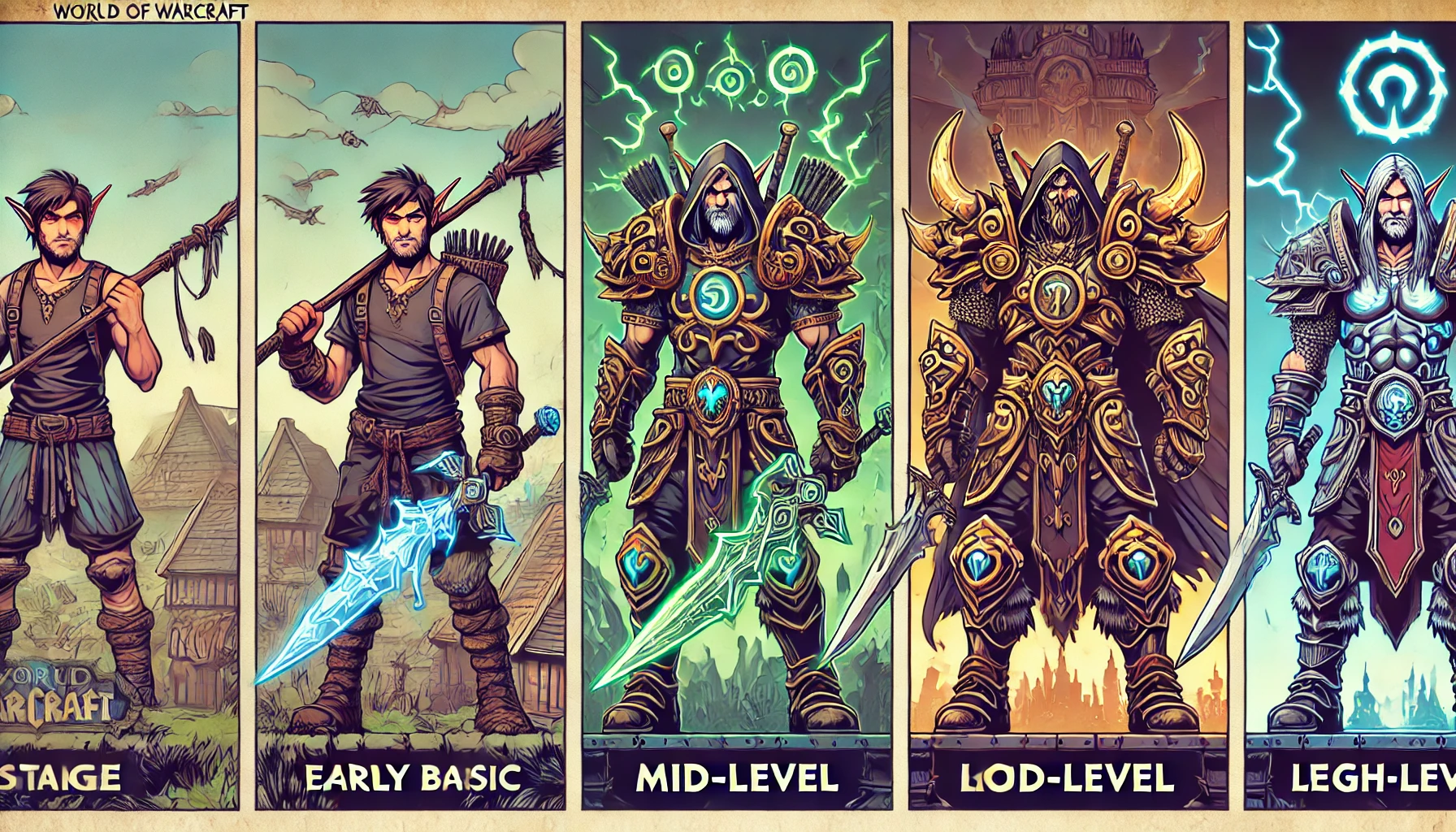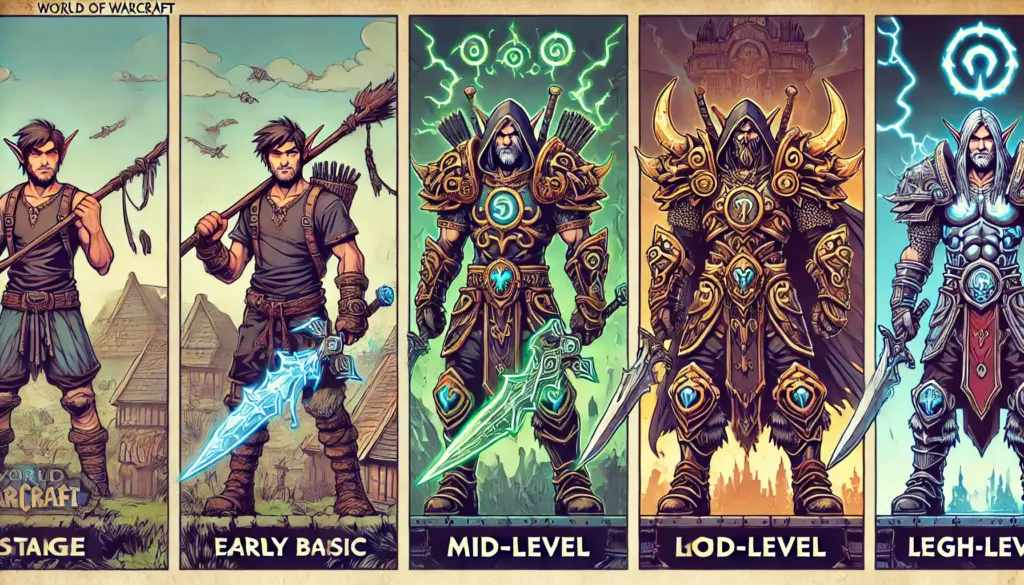Stand: Dezember 2024
Seit geraumer Zeit kursieren im Netz Gerüchte über eine mögliche Nachfolger-Konsole zur Nintendo Switch, oft als „Nintendo Switch 2“, „Switch Pro“ oder „Super Switch“ bezeichnet. Obwohl Nintendo bislang keine offiziellen Details bestätigt hat, verdichten sich Berichte und Leaks immer weiter. Im Folgenden sind alle wichtigen Informationen zusammengetragen, die aktuell öffentlich diskutiert werden – mit einem Blick auf potenzielle Hardware-Spezifikationen, Release-Fenster und erste Pressestimmen.

Gerüchte und mögliche Features
- Möglicher Release-Zeitraum
- Mehrere Branchen-Insider (darunter Analysten und Journalist*innen) gehen von einem Release im Jahr 2024 oder Anfang 2025 aus.
- Ein Grund für diesen Zeitrahmen: Die Switch erschien 2017, und Nintendo strebt typischerweise einen Produktzyklus von etwa fünf bis sieben Jahren pro Konsolengeneration an.
- Leistungsstärkeres Innenleben
- Laut diversen Berichten soll die neue Konsole auf einem aktuellen NVIDIA-Chip basieren. Dieser könne DLSS (Deep Learning Super Sampling) unterstützen, was ein hochskaliertes 4K-Bild am Fernseher ermöglichen würde.
- Im mobilen Betrieb sei eine höhere native Auflösung als die bisherige 720p-Switch-Display denkbar (möglicherweise 1080p).
- Größeres oder verbessertes Display
- Gerüchte besagen, dass Nintendo wieder auf ein OLED-Panel setzen könnte – wie bei der Switch (OLED-Modell).
- In manchen Leaks ist von einem Display zwischen 7 und 8 Zoll die Rede, was dem Trend zu größeren Handheld-Bildschirmen folgen würde.
- Kompatibilität mit Switch-Spielen
- Ein heikles Thema ist die Abwärtskompatibilität. Nintendo hat sich nicht offiziell dazu geäußert, ob Switch-Spiele auf dem neuen Gerät spielbar sein werden. Die Community hofft darauf, zumal die digitale Bibliothek der aktuellen Switch sehr umfangreich ist.
- Einige Insider vermuten zumindest eine digitale Abwärtskompatibilität, da Nintendo das Ökosystem der eShop-Titel ungern zerschlagen würde.
- Neues Design und Joy-Con-Überarbeitung
- Nachdem die Joy-Cons der aktuellen Switch wegen Drifting-Problemen immer wieder in der Kritik standen, wird über eine Joy-Con-Neuentwicklung spekuliert. Ob der modulare Ansatz (abnehmbare Controller) beibehalten wird, ist bislang unklar.
- Verschiedene Patente deuten zudem auf mögliche neue Features (z. B. Touchpads oder verbesserte Bewegungssensoren) hin.
- Software-Lineup zum Start
- Über konkrete Starttitel wird viel gemutmaßt. Ein neues „Mario Kart“, ein 3D-Mario-Abenteuer oder ein weiterer Zelda-Titel gelten als mögliche Zugpferde für einen starken Launch.
- Auch diverse Third-Party-Entwickler*innen könnten zum Launch Unterstützung bieten, sollten Dev-Kits bereits im Umlauf sein.
Relevante Pressestimmen
- Bloomberg:
„Nintendo könnte mit einer leistungsfähigeren Switch-Iteration den Zeitgeist treffen – insbesondere im Hinblick auf 4K-Fernseher und das wachsende Interesse an Cloud-Gaming.“
– (Bloomberg.com) - Eurogamer:
„Quellen aus dem Umfeld von Entwicklungsteams berichten, dass Nintendo bereits Dev-Kits für eine Next-Gen-Konsole verteilt. Fans sollten sich jedoch gedulden, da ein offizielles Statement noch auf sich warten lassen dürfte.“
– (Eurogamer.net) - IGN:
„Eine mögliche Switch 2 hat das Potenzial, die Stärken des Hybrid-Designs noch weiter auszubauen. Doch die Frage ist: Kann Nintendo weiterhin so innovativ sein, wie beim Originalkonzept der Switch?“
– (IGN.com) - Digital Foundry (via Eurogamer):
„Sollte Nintendo auf DLSS-Technologie setzen, wäre eine echte 4K-Ausgabe – zumindest hochskaliert – im TV-Modus realistisch. Das wäre für ein Nintendo-Gerät ein beachtlicher technischer Fortschritt.“ - Nintendo Life:
„Die Switch-Community hofft vor allem auf Abwärtskompatibilität. Würden Switch-Spiele auch auf der Nachfolger-Konsole laufen, wäre das für viele Fans ein Kaufargument Nummer eins.“
– (NintendoLife.com)
Offizielle Statements von Nintendo
Offiziell hält sich Nintendo bedeckt. Reggie Fils-Aimé (ehemaliger Nintendo-of-America-Präsident) und Shuntaro Furukawa (aktueller Nintendo-Präsident) betonten bei verschiedensten Gelegenheiten, dass man immer auf der Suche nach neuen Wege sei, die Spielerinnen zu überraschen. Konkrete technische Details oder ein Release-Datum wurden jedoch nie genannt. Furukawa verwies lediglich darauf, dass die Switch „noch mitten im Lebenszyklus“ stehe (Stand 2022), was Analystinnen jedoch unterschiedlich interpretieren.
Einschätzung: Chancen und Herausforderungen
Chancen
- Ein leistungsstärkeres Gerät könnte die Switch-Familie auf das nächste Level heben und 4K-Gaming zumindest im hochskalierten Modus ermöglichen.
- Eine weiterhin hybride Nutzung (Handheld & Dockingstation) wäre ein logischer Fortschritt und würde das Erfolgsrezept der Switch bewahren.
- Starke First-Party-Titel (Mario, Zelda, Pokémon) würden vermutlich wieder für hohe Verkäufe sorgen.
Herausforderungen
- Das Preissegment: Eine deutlich leistungsfähigere Hardware könnte merklich teurer werden als die aktuelle Switch.
- Konkurrenzdruck durch Steam Deck und andere Handheld-PCs wie das ASUS ROG Ally, die bereits fortschrittliche Technik im Mobilformat bieten.
- Fans erwarten Abwärtskompatibilität – sollte Nintendo darauf verzichten, könnte dies einen Shitstorm auslösen.
Quellenverzeichnis
- Bloomberg
- Eurogamer
- IGN
- Digital Foundry (Tochter von Eurogamer)
- Nintendo Life
(Bitte beachten: Manche Artikel liegen hinter einer Paywall oder sind nur in Teilen öffentlich zugänglich.)
Fazit
Die Nachfolger-Konsole zur Nintendo Switch – wie immer sie letztlich heißen wird – ist ein heißes Thema in der Gaming-Welt. Auch wenn viele Details aktuell nur auf Insider-Informationen und Leaks basieren, scheint klar zu sein, dass Nintendo an einer neuen Hardware arbeitet, die die Erfolgsgeschichte der Switch fortschreiben könnte. Ob es einen leistungsfähigeren Chip mit DLSS-Unterstützung, ein größeres OLED-Display und Abwärtskompatibilität geben wird, bleibt vorerst spekulativ. Eins steht aber fest: Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 wird weiter brodeln, bis Nintendo selbst den Vorhang lüftet.
Hinweis: Da Nintendo bis zum jetzigen Zeitpunkt keine offizielle Ankündigung gemacht hat, sind alle genannten Features und Termine als Gerüchte zu betrachten.